Mehr fühlen, weniger denken.
Was genau ist Achtsamkeit eigentlich?
Achtsamkeit kurz erklärt
Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit absichtsvoll auf den gegenwärtigen Moment zu richten – auf innere Vorgänge (Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen) und äußere Eindrücke – und das möglichst ohne zu urteilen.
Vielleicht gehst Du regelmäßig ins Fitnessstudio oder fährst Inline-Skates, joggst oder kletterst. In jedem Fall trainierst Du Deine Muskeln.
Unsere Aufmerksamkeit läuft dabei oft auf Autopilot, sodass unsere mentale Fitness auf der Strecke bleibt. Dabei will – muss! – auch unser Geist trainiert werden, vor allem, wenn wir unser Leben aktiv steuern und nicht fremdbestimmt sein wollen. Denn selbst wenn wir „nur” emotional reagieren, sind wir in gewisser Weise fremdbestimmt. Nämlich von unseren Gedanken und Emotionen.
Achtsamkeit holt uns ins Hier und Jetzt. Sie hilft uns, klarer wahrzunehmen, ruhiger zu reagieren und freundlicher mit uns selbst zu sein.
Trainiere Deinen Aufmerksamkeitsmuskel
Unser Geist schweift ab, bewertet im Sekundentakt und macht Tempo. Mit Achtsamkeit trainieren wir das Gegenteil: präsent zu sein, ohne zu urteilen oder loszustürmen. Mit der Zeit werden wir innerlich ruhiger und treffen Entscheidungen bewusster.
Achtsamkeit ist kein Hype, sondern alltagstauglich
Bis vor einigen Jahren passte sie nicht so recht in unsere Leistungsgesellschaft. Doch das hat sich mittlerweile ein Stück weit geändert. Vielen Menschen wird bewusst, dass es am Ende des Tages egal ist, wie viele Überstunden wir gemacht haben, wie viel Geld wir verdienen oder welche Autos wir fahren bzw. welche Luxusmarken wir tragen.
Am Ende des Tages zählt nur, dass wir gesund sind… dass wir einen Tag in Liebe und Freundschaft verbracht haben… dass wir authentisch waren und uns selbst treu geblieben sind, so gut wir konnten. Und dass wir zufrieden in unser Spiegelbild schauen können.
Achtsamkeit ist keine esoterische Kür. Sie ist eine Haltung für Deinen Alltag: bei der Arbeit, zu Hause, unterwegs. Gerade in fordernden Momenten schenkt sie Dir einen kleinen Abstand zwischen Reiz und Reaktion – genau den Raum, in dem Du wählen kannst, wie Du handeln möchtest.
Auch beruflich wichtig, nicht nur privat
Das eine schließt das andere nicht aus. Achtsamkeit will auch im Beruf geübt werden, egal ob man Mitarbeiter:in oder Führungskraft ist. Gerade Führungskräften lege ich ans Herz, sich mit Achtsamkeit und Resilienz auseinanderzusetzen. Mit ihnen steht und fällt die Motivation ihres Teams – und je besser sie führen, desto bessere Ergebnisse erzielt ihr Team.
Das Gleiche gilt für Erzieher:innen oder Eltern. Wir neigen dazu, unseren Kindern unsere eigene Weltanschauung näherzubringen. Dazu gehören auch unsere negativen Überzeugungen. Je mehr wir über Achtsamkeit und Resilienz wissen, desto eher können wir unseren Kindern Raum geben, ihre eigene Weltanschauung zu entwickeln, ohne unsere eigenen Ängste und Sorgen zu übernehmen. Diese sind uns ohne Achtsamkeitstraining oft gar nicht bewusst.
Leben auf Autopilot
Kennst Du das, wenn Du das Abendessen vorbereitest? Du schneidest Gemüse, rührst im Topf, deckst den Tisch – und plötzlich ist alles fertig. Doch Du erinnerst Dich kaum an den Duft, an die Farben oder an die Handgriffe. Deine Gedanken waren schon bei Mails, Terminen oder kleinen Sorgen. Das ist Autopilot: Der Körper funktioniert, doch der Kopf ist woanders.
Autopilot ist normal. Unser Geist schweift häufig ab. Wenn wir jedoch zu lange darin verharren, übersehen wir Chancen im Alltag und werden gereizter oder müder. Chancen wollen gesehen und ergriffen werden. Wenn wir nur noch funktionieren, von Termin zu Termin hetzen und Dinge erledigen, nehmen wir unseren Körper nicht mehr als Wunder wahr, sondern als etwas, das einfach funktionieren muss. Dann melden sich Körper und Seele mit Signalen: verspannte Schultern, flacher Atem, Unruhe. Diese Signale laden Dich ein, präsenter zu werden und freundlicher mit Dir umzugehen.
Also, was ist das nun… Achtsamkeit?
Achtsamkeit bedeutet,
- sich dessen bewusst zu sein, was genau jetzt, in diesem Moment, innerlich und äußerlich geschieht, und
- dieses Geschehen ruhig und entspannt zu beobachten.
Mehr geschieht zunächst nicht. 😊 Wir greifen nicht ein und müssen auch nichts tun.
Was bedeutet Achtsamkeit konkret?
Achtsamkeit bedeutet, wahrzunehmen, was jetzt geschieht – in Dir und um Dich herum – und es ruhig zu beobachten. Weder wegdrücken noch dramatisieren. Da sein, fühlen, atmen.
Obwohl Achtsamkeit als eine besondere Form der Aufmerksamkeit bezeichnet werden kann, ist sie nicht dasselbe. Achtsamkeit unterscheidet sich auch deutlich von der Konzentration im herkömmlichen Sinne.
Wenn wir uns beispielsweise auf das Lösen einer bestimmten Aufgabe konzentrieren, richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit darauf. Diese Art der Aufmerksamkeit ist in ihrer Wahrnehmung begrenzt.
Achtsamkeit hingegen verfolgt kein bestimmtes Ziel. Es geht nur um das Hier und Jetzt. Dabei schränken wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit nicht ein, sondern sind offen für die ganze Fülle der Wahrnehmung. Kennzeichnend ist, dass wir lediglich Beobachter sind, die das Wahrgenommene benennen, aber nicht bewerten.
Aufmerksamkeit wird zu Achtsamkeit,
wenn man absichtlich und ohne zu werten beobachtet, im Augenblick bleibt und nicht reagiert.
Jeder Moment ist einmalig
Achtsamkeit besagt im Wesentlichen, dass jeder einzelne Moment unglaublich einmalig ist. Keiner ist besser als der andere. Es geht vielmehr um die Frage, wie wir mit den erfreulichen und unerfreulichen Momenten umgehen – und den anderen, die gerne übersehen werden.
Wissenschaftlich belegt
Mehrere wissenschaftliche Studien belegen, dass regelmäßiges Achtsamkeitstraining die Lebensqualität verbessern kann. Auch depressive Verstimmungen können durch kontinuierliches Achtsamkeitstraining positiv beeinflusst werden.
Die Rückbesinnung auf das Hier und Jetzt kann dabei helfen, aus eingefahrenen Verhaltens- und Denkmustern auszubrechen. In Stresssituationen reagiert man so ruhiger und gelassener. Mit etwas Übung lassen sich auch negative Denkmuster überwinden.
Das Konzept der Achtsamkeit stammt ursprünglich aus dem Buddhismus. In den 1970er Jahren entwickelte der Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn auf dieser Grundlage die achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung (MBSR). Dabei handelt es sich um eine Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, Körperwahrnehmung, Yoga-Übungen und Meditation. Ich persönlich würde jedoch niemals meditieren, wenn es mir schlecht geht. Inzwischen wird MBSR auf der ganzen Welt gelehrt. Dabei spielt Religion keine Rolle.
Was bedeutet Wahrnehmung im Sinne von Achtsamkeit konkret?
Je mehr wir die Schlüssel zur Achtsamkeit trainieren, desto mehr durchbrechen wir unsere Gewohnheiten. Das heißt, dass wir nicht mehr automatisch und unbewusst auf das reagieren, was wir gerade erleben.
Dadurch können wir in Situationen viel adäquater, selbstbewusster und vor allem authentischer handeln.
Die 4 Schlüssel der Achtsamkeit sind:
1 | Beobachten – Wahrnehmen, wie es jetzt ist
Beim Beobachten ruht Deine Aufmerksamkeit auf dem, was außen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) und innen (Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen) gerade geschieht. Du nimmst es bewusst wahr, ohne etwas zu verändern oder zu erklären. Durch diese schlichte Präsenz holst Du Dich aus dem Autopiloten in den Moment. Achtsamkeit wird dabei klassisch als aufmerksames, nicht wertendes Wahrnehmen des gegenwärtigen Moments beschrieben.
Dabei ist es wichtig, sich selbst gegenüber offen, neugierig und freundlich zu verhalten. Das Beobachten schafft einen gewissen Abstand zur Erfahrung, nicht, um Dich zu „korrigieren“, sondern um klarer zu sehen, was wirklich da ist. Das unterstützt Präsenz auch in fordernden Situationen.
Eine bewährte Form ist der Body-Scan, um den Körper im Detail zu durchwandern und Empfindungen wahrzunehmen. Das Ziel des Beobachtens ist es, eine Distanz zu unseren Erfahrungen zu schaffen, sodass wir sie klarer sehen und nicht sofort reagieren.
Kurz gefasst: Wir nehmen genau wahr, was wir wahrnehmen, ohne einzelne Objekte, Emotionen oder Ähnliches in den Fokus zu stellen, sie zu bewerten oder gar zu handeln.

Gegenwarts-Scan
- Ankommen: Spüre Deine Füße am Boden und lasse die Schultern sinken
- Atem: Nimm drei ruhige Atemzüge, das Ausatmen jeweils einen Moment länger
- Außen: Benenne in Gedanken leise zwei Dinge, die Du siehst oder hörst
- Innen: Bemerke eine Empfindung im Körper (z. B. Druck, Wärme, Ruhe)

In drei Worte fassen
- Ankommen: Füße am Boden spüren, Schultern sinken lassen
- Atem: Drei ruhige Atemzüge, beim Ausatmen jeweils einen Moment länger
- Benennen: Je ein Wort für 1) Gefühl, 2) Körper, 3) Gedanken
- Weiter: So stehen lassen. Erst danach entscheiden, was als Nächstes dran ist.
2 | Benennen – Worte schaffen Abstand
Benennen bedeutet, dass wir unsere Beobachtungen in Worte fassen, um unsere Wahrnehmungen zu klären und zu strukturieren. Das hilft uns, die Vielzahl von Eindrücken und inneren Erlebnissen zu ordnen und bewusster wahrzunehmen. Wenn wir beispielsweise Angst empfinden, können wir diese benennen, indem wir uns sagen: „Ich habe Angst.“ Dadurch distanzieren wir uns ein Stück weit von dem Gefühl oder Gedanken und verringern seine Macht über uns.
Wenn wir nüchtern und präzise, ohne zu erklären oder zu analysieren, in Worte fassen, was wir im Inneren wahrnehmen, kann uns das dabei helfen, bestimmte Gedanken oder Gefühle zu erkennen, die oft unbewusst bleiben, uns aber beeinflussen. Darüber hinaus kann das Benennen von Emotionen, wie zahlreiche Studien zeigen, deren Intensität verringern. Das Benennen ermöglicht es uns, besser zu verstehen, was in uns vorgeht, und schafft eine Grundlage für überlegte und konstruktive Entscheidungen.
Dadurch durchbrechen wir Automatismen und reagieren langsamer und vor allem weniger emotional. Außerdem fördert diese Praxis unsere Selbstwahrnehmung und dient als Brücke zwischen der reinen Beobachtung und den nächsten Schritten der Achtsamkeitspraxis.
Studien zeigen: Gefühle in Worte zu fassen kann die emotionale Reaktivität im Gehirn dämpfen (u. a. geringere Amygdala-Aktivität).
Ein Beispiel:
- Wenn wir eine Grille zirpen hören, bezeichnen wir das Geräusch als „Zirpen“.
- Die Grille selbst zu benennen, wäre hingegen keine Bezeichnung, sondern eine Schlussfolgerung, die wir aufgrund des Geräusches ziehen.
3 | Nicht urteilen – Beschreiben statt bewerten
Nicht zu urteilen bedeutet, unsere Beobachtungen und Wahrnehmungen zu akzeptieren, ohne sie zu bewerten oder zu verurteilen. Das ist oft eine Herausforderung, denn unser Geist neigt dazu, sofort zu urteilen: gut oder schlecht, angenehm oder unangenehm, richtig oder falsch – je nachdem, welche individuellen Erfahrungen wir gemacht haben oder welche Vorurteile wir besitzen.
„Nicht urteilen“ ist ein zentraler Bestandteil gängiger wissenschaftlicher Definitionen von Achtsamkeit.
Selten hinterfragen wir unser erstes, schnell getroffenes Urteil. Wenn wir uns allerdings darin üben, nicht zu urteilen, sondern uns selbst gegenüber neutral und freundlich zu sein, erlauben wir uns, unsere Erfahrungen so anzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu kategorisieren oder mit Erwartungen aufzuladen. Wir ersetzen Etiketten durch Beobachtungen.
Diese neutrale und freundliche Haltung hilft uns, einen objektiveren Blick auf unsere Gefühle und Gedanken zu entwickeln. Anstatt zum Beispiel zu denken: „Dieser Gedanke ist schlecht und ich sollte nicht so fühlen“, akzeptieren wir den Gedanken einfach als das, was er ist: nur ein Gedanke. Diese Haltung der Neutralität kann dabei helfen, die emotionale Reaktivität zu reduzieren und eine gelassenere Geisteshaltung zu kultivieren.

Satz neu schreiben
- Ankommen: Ein ruhiger Atemzug, der Blick wird weich.
- Umschreiben: Ersetze in einem Satz die Wertung durch eine Beschreibung. Aus „Ich bin furchtbar unkonzentriert“ wird beispielsweise „Meine Gedanken springen hin und her, meine Augen fühlen sich müde an“.
- Als Nächstes wähle den nächsten kleinen Schritt.
Langfristig ermöglicht dies eine tiefere Akzeptanz und Toleranz uns selbst und anderen gegenüber. Das Nicht-Urteilen fördert ein tieferes Verständnis und Mitgefühl für das eigene innere Erleben sowie für Situationen und Menschen in unserer Umgebung. So kann dieser Ansatz zu einer klareren und ausgeglicheneren Wahrnehmung sowie zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit beitragen.
Wir vermeiden Vorurteile und übereilte Urteile.
Kurz gefasst: Wir alle neigen dazu, in Schubladen zu denken. Der eine mehr, der andere weniger – doch der erste Eindruck ist schnell gemacht.
Durch die achtsame Haltung des Nicht-Bewertens durchbrechen wir diese unbewusste Beurteilungsgewohnheit und können unser Verhalten reflektieren, anstatt zu reagieren. Dadurch gewinnen wir eine objektivere und bewusstere Wahrnehmung.

STOP
- S – Stop: Stoppen oder innehalten
- T – Take a breath: Atme tief durch
- O – Observe: Beobachte Deinen Körper, Deine Gedanken, Gefühle, Emotionen und körperlichen Empfindungen
- P – Proceed: Was hilft jetzt? Fahre mit mehr Bewusstsein fort
4 | Nicht reagieren – Reiz, Pause, Antwort
„Nicht reagieren“ bedeutet, unseren natürlichen Impuls, sofort auf innere oder äußere Reize zu reagieren, zu unterdrücken. In der Praxis bedeutet dies, dass wir uns die Zeit nehmen, das Beobachtete, Benannte und Wahrgenommene ohne Bewertung zu erleben, statt sofort zu handeln. Oft sind unsere ersten Reaktionen automatisch und emotional, was zu unüberlegten Handlungen führen kann.
Nicht zu reagieren ermöglicht es uns, innezuhalten und bewusstere Entscheidungen zu treffen. Dieses Innehalten hilft uns, überlegter und effektiver mit Herausforderungen umzugehen. Durch das bewusste Nicht-Reagieren können wir lernen, unsere Impulse zu kontrollieren und die Tiefe unserer Reaktionen zu erforschen. Dies fördert eine Haltung der Geduld und Selbstkontrolle und kann uns dabei unterstützen, mit Stress und Konflikten im Alltag besser umzugehen.
Langfristig ermöglicht dies eine tiefere Akzeptanz und Toleranz uns selbst und anderen gegenüber. Das Nicht-Urteilen fördert ein tieferes Verständnis und Mitgefühl für das eigene innere Erleben sowie für Situationen und Menschen in unserer Umgebung. So kann dieser Ansatz zu einer klareren und ausgeglicheneren Wahrnehmung sowie zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit beitragen.
Wir vermeiden Vorurteile und übereilte Urteile.
Kurz gefasst: Wir alle neigen dazu, in Schubladen zu denken. Der eine mehr, der andere weniger – doch der erste Eindruck ist schnell gemacht.
Durch die achtsame Haltung des Nicht-Bewertens durchbrechen wir diese unbewusste Beurteilungsgewohnheit und können unser Verhalten reflektieren, anstatt zu reagieren. Dadurch gewinnen wir eine objektivere und bewusstere Wahrnehmung.
Freunde Dich mit Deiner eigenen Erfahrung an
Achtsamkeit ist ein Weg, sich mit der eigenen Erfahrung anzufreunden. Mit dem Guten, dem Schlechten und dem Hässlichen, und klug damit umzugehen, sodass man in einem gewissen Sinn das Auf und Ab eines Lebens steuern kann mit vollem Bewusstsein und einem gewissen Maß an Gelassenheit und Mitgefühl für sich selbst.
Der Nutzen von Achtsamkeit
Wie oben bereits angedeutet, haben Studien gezeigt, dass selbst relativ kurze Achtsamkeitsprogramme, die regelmäßig durchgeführt werden, mit zum Teil erheblichen Veränderungen einhergehen. Zum Beispiel
- können sich das Kurzzeitgedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit verbessern
- können wir Informationen schneller und präziser verarbeiten
- können Stress, Angstzustände, Depressionen und Burnout reduziert werden
- sind wir emotional stabiler und haben unsere Gefühle im Umgang mit anderen besser im Griff
- können sich unsere Beziehungen verbessern
- können sich unsere Kreativität wie auch unsere Fähigkeiten zu Empathie und Mitgefühl verbessern
- sind wir weniger anfällig für Grippeviren.
Viele weitere positive Aspekte sprechen für das Achtsamkeitstraining.
Achtsamkeit im Alltag
Wie kannst Du nun Achtsamkeit in Deinen Alltag integrieren?
Das ist gar nicht so schwer. Im Artikel „3 Atemübungen für mehr Gelassenheit – nicht nur in Krisen“ zeige ich Dir ein paar einfache Übungen, die auch Anfängern den Einstieg in das Thema Achtsamkeit erleichtern.
Bist Du schon achtsam und spürst eine Wirkung?
Erzähl‘ uns gerne in den Kommentaren davon. Sharing is caring. ❤️😊
Bist Du depressiv und brauchst Hilfe?
Wenn Du schon mitten in einer Depression steckst, ist es gut möglich, dass Dir Achtsamkeitsübungen nicht so gut helfen, wie Du es vielleicht brauchst.
Auf der Suche nach einem geeigneten Therapeuten wirst Du vielleicht bei Psychotherapeut*innen-Suche der DPtV oder bei Therapeut*innen finden auf therapie.de fündig.
Auch die Telefonseelsorge hat ein offenes Ohr und kann Dir weiterhelfen.
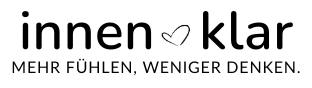






Ehrlich gesagt, konnte ich mit Achtsamkeit bisher nicht so viel anfangen. Das klingt mir sehr anstrengend, dauernd darauf zu achten, wie ich was tue oder so. Aber das mit den Gedanken stimmt schon. Ich werde versuchen, mehr darauf zu achten, was ich denke.
Hallo Sandra,
bei der Achtsamkeit geht es lediglich darum, sich über destruktive Gedanken- oder Verhaltensmuster bewusst zu werden. Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir sie verändern. Das bedeutet nicht, dass wir uns ständig damit beschäftigen und darauf achten sollen, im Gegenteil. Nur, wenn es uns auffällt, dass wir wieder mal negativ denken und daraus resultierend uns schlecht fühlen oder so agieren, wie es sich nicht gut anfühlt, dann hilft z.B. Ablenkung durch ein schönes Gespräch mit der Freundin oder durch ein Hobby, bei dem wir die Zeit vergessen. Im Grunde also, die negativen Gedanken zu ignorieren und nicht, sich damit beschäftigen. Auch diese Übungen können dabei helfen: https://claudiagund.com/tag/uebungen/ Probiere es aus, Du wirst sehen, es hilft. 😊